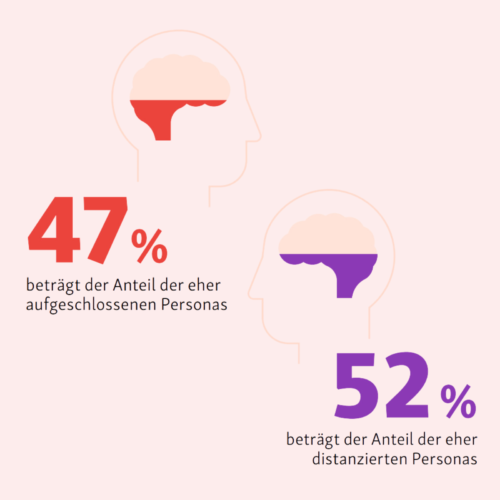„Wir brauchen eine Messmethode für positive Auswirkungen grüner digitaler Technologien auf die Umwelt.“

Frau Superti, ein wichtiger Teil des Strategic Foresight Report 2022 der Europäischen Kommission ist das Zusammenwirken des digitalen und grünen Wandels. Beide Transformationsprozesse stehen ganz oben auf der politischen Agenda der Europäischen Kommission und ihr Zusammenspiel wird die Zukunft massiv beeinflussen. Ihr Erfolg wird auch für das Erreichen der „Ziele für nachhaltige Entwicklung“ der Vereinten Nationen entscheidend sein. Gleichzeitig ist die digitale Transformation bisher nur in begrenztem Maße unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit erfolgt und hat auch einige schwerwiegende negative Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit. Was sind die nächsten wichtigen Schritte, die die Europäische Kommission zu unternehmen gedenkt, um diese negativen Auswirkungen zu verringern und sicherzustellen, dass der digitale Wandel die ökologische Nachhaltigkeit und den grünen Wandel fördert?
Wir in der Europäischen Kommission sind überzeugt, dass digitale Technologien eine wesentliche Rolle für den Erfolg des grünen Wandels spielen. Im Energiesektor ermöglichen sie die Gewinnung erneuerbarer Energien in großem Maßstab und gleichen das Stromnetz durch virtuelle Energiespeichersysteme aus. Im Bereich der Mobilität findet man sie in Elektrofahrzeugen und der erforderlichen Ladeinfrastruktur. In unseren Häusern können intelligente Heizsysteme den Energieverbrauch durch Sensoren, intelligente Zähler und Energiemanagementlösungen senken. In der Landwirtschaft ermöglichen neue Geschäftsmodelle, die durch digitale Technologien entstehen, landwirtschaftliche Geräte gemeinsam zu nutzen und so Kosten und Produktionsemissionen zu senken. Die sektoralen Beispiele sind eindeutig.
Es stimmt jedoch, dass digitale Technologien einen erheblichen CO2-Fußabdruck hinterlassen können. Das unterstreicht die Notwendigkeit dafür, dass die digitale Wirtschaft – wie alle anderen Sektoren auch – eine nachhaltige Entwicklung anstrebt. Die Europäische Kommission engagiert sich stark für diese Ziele, wie ihr Arbeitsprogramm 2023 zeigt. Zwei der Hauptziele des Programms, nämlich die Umsetzung des Green Deal und die Vorbereitung Europas auf das digitale Zeitalter, sind nicht automatisch miteinander verbunden. Es ist wichtig, die dringendsten Herausforderungen anzugehen und gleichzeitig den langfristigen Kurs beizubehalten.
Um sicherzustellen, dass die europäische Industrie einen nachhaltigen Wandel vollzieht und gleichzeitig in globalen Wertschöpfungsketten wettbewerbsfähig und widerstandsfähig bleibt, hat die Kommission eine breite Palette von Maßnahmen vorgeschlagen und umgesetzt. Diese werden eine wichtige Rolle bei der Förderung nachhaltiger Investitionen in der EU spielen, indem sie Unternehmen, Investoren und politischen Entscheidungsträgern geeignete Definitionen dafür an die Hand gibt, welche Wirtschaftstätigkeiten als ökologisch nachhaltig angesehen werden können. Neben dieser Taxonomie gibt es auch Vorschriften zur umweltgerechten Gestaltung, die sicherstellen, dass elektronische Geräte die Anforderungen an die Energieeffizienz erfüllen. Beispielsweise wird die Ökodesign-Verordnung der Kommission für Server und Datenspeicherprodukte zu Stromeinsparungen von bis zu 9 TWh/Jahr führen, was dem jährlichen Stromverbrauch Estlands im Jahr 2014 entspricht. Außerdem werden die Treibhausgasemissionen um bis zu 3 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr reduziert. Mit Blick auf die Zukunft wird der Europäische Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft der Kommission dazu beitragen, die Menge an Elektro- und Elektronik-Altgeräten zu verringern, wie z. B. die Verordnung über ein europaweit einheitliches Ladegerät für tragbare elektronische Geräte bis 2024 zeigt. Derzeit werden in der EU weniger als 40 % des gesamten Elektroschrotts recycelt. Dies ist nur ein kleiner Teil der Bemühungen der Europäischen Union, einen Binnenmarkt zu schaffen, der als Maßstab für nachhaltige Technologie, Innovation und Wachstum dient.
Derzeit wird viel über die Auswirkungen des digitalen Sektors auf die grüne Transformation gesprochen – sei es über die negativen Auswirkungen von Elektroschrott, den Energieverbrauch digitaler Geräte, das steigende Konsumverhalten usw. oder darüber, wie digitale Technologien eine Schlüsselrolle bei der Erreichung von Klimaneutralität spielen könnten. Doch wie kann und wird das Streben der Europäischen Kommission nach einer grünen Transformation den digitalen Sektor verändern? Welche Maßnahmen kann und will die Europäische Kommission ergreifen, um sicherzustellen, dass der digitale Wandel wesentlich nachhaltiger abläuft als in der Vergangenheit?
Der grüne Wandel ist ein Muss für ausnahmslos alle Sektoren, einschließlich der Digitalwirtschaft. Die Kommission verfolgt einen integrativen Ansatz, der dazu beiträgt, die verschiedenen Akteure auf klimaneutrale Maßnahmen auszurichten und gleichzeitig einen gerechten Übergang zu gewährleisten. Diese beiden Elemente müssen gut ausbalanciert sein und erfordern eine Vielzahl von Interessenvertreter*innen, die in Schlüsselfragen zusammenarbeiten, um ihre Ziele zu erreichen. Zu diesem Zweck hat die Kommission das Europäische Industrieforum eingerichtet. Das Forum setzt sich aus Vertreter*innen der Industrie und der Mitgliedstaaten sowie politischen Entscheidungsträgern zusammen, die gemeinsam an der Entwicklung spezifischer Transformationspfade für jeden Sektor der EU-Wirtschaft oder, wie wir es nennen, des „industriellen Ökosystems“ arbeiten. Die Transformationspfade zeigen Lücken, Synergien und Bereiche für grenzüberschreitende Zusammenarbeit auf, um den digitalen und nachhaltigen Wandel zu beschleunigen. Die Initiative zielt darauf ab, kleine und mittlere Unternehmen (KMU) – das Rückgrat der europäischen Industrie – dabei zu unterstützen, den Transformationsprozess zu bewältigen und gleichzeitig wettbewerbsfähig und widerstandsfähig zu bleiben. Der digitale Sektor ist von jedem Transformationspfad betroffen, der konkrete zukünftige Maßnahmen der Sektoren zur Dekarbonisierung und zum Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit beschreibt. Zur Unterstützung der KMUs in Europa hat die Kommission spezifische Initiativen ergriffen, beispielsweise das European Enterprise Network (EEN). Das Netzwerk bietet spezielle Dienstleistungen für einzelne KMUs an, die Unterstützung bei der Umsetzung der Zwillingstransformation benötigen.
Über diese Transformationspfade hinaus möchte ich zwei Initiativen hervorheben, die in diesem Zusammenhang von Bedeutung sind. Die erste betrifft die Messbarkeit. Im Vergleich zur Messung der negativen Auswirkungen elektronischer Produkte ist die Messung der positiven Umweltauswirkungen digitaler Technologien nicht einfach. Wir brauchen eine robuste Methode zur Berechnung der Nettoauswirkungen grüner digitaler Technologien auf die Umwelt und das Klima. Die Einführung neuer Indikatoren kann bei der Bewertung der positiven Auswirkungen von Initiativen hilfreich sein, wie dies beispielsweise bei der European Green Digital Coalition (EGDC) der Fall ist. Diese von der Industrie geführte und von der Kommission und dem Europäischen Parlament unterstützte Initiative hat genau dieses Ziel: in die Entwicklung und den Einsatz umweltfreundlicherer digitaler Technologien zu investieren und eine Standardmethode zur Messung ihrer Nettoauswirkungen zu entwickeln. Wenn wir uns auf die digitale Wirtschaft konzentrieren, müssen wir uns auch mit den Lieferketten und den verwendeten Materialien befassen. Mit dem Gesetz über kritische Rohstoffe, das die Kommission 2023 vorlegen will, soll die Verfügbarkeit von Rohstoffen, von denen viele für den digitalen Wandel unerlässlich sind, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsanforderungen sichergestellt werden. Die EU trägt eine große Verantwortung für das Gelingen dieses Übergangs. Es ist auch klar, dass dieser digitale Wandel ein koordiniertes Vorgehen der Regierungen, des Privatsektors und der Gesellschaft insgesamt erfordert, um den Übergang Europas zu einer ressourceneffizienten und wettbewerbsfähigen Wirtschaft sicherzustellen.
Die Europäische Kommission sagt, dass der digitale Wandel aufgrund seines enormen wirtschaftlichen Potenzials vor allem von der Privatwirtschaft vorangetrieben wird, dass aber auch staatliches und zivilgesellschaftliches Engagement erforderlich ist, um seine Vorteile für eine umweltverträgliche Entwicklung zu nutzen und seine negativen Auswirkungen zu begrenzen. Können Sie dies näher erläutern? Was können Regierungen und Zivilgesellschaft tun, um die Zwillingseffekte dieser beiden Übergänge zu unterstützen?
Der digitale Wandel ist eine Herausforderung, aber wenn er richtig angegangen wird, bietet er auch große wirtschaftliche Chancen, von denen die Gesellschaft als Ganzes profitieren wird. Der öffentliche Sektor spielt eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, den Wandel zu beschleunigen und für alle Teile der Gesellschaft nutzbar zu machen. Was die EU betrifft, so habe ich bereits einige unserer Strategien und Initiativen erwähnt. Was für die EU und die Kommission gilt, gilt auch für alle Regierungsebenen in der EU. Insbesondere müssen die Regierungen sicherstellen, dass es Strategien und eine gute Koordinierung zwischen den verschiedenen Interessengruppen gibt. Das bedeutet, dass ein geeigneter Rahmen für Investitionen geschaffen sowie sichergestellt werden muss, dass Nachhaltigkeitsanforderungen und -standards für Produkte und Dienstleistungen klar definiert und eingehalten werden. Dies fördert ein gutes wirtschaftliches Umfeld mit klaren gesetzlichen Anforderungen und geeigneten Anreizen. Die Unterstützung der Wirtschaftsakteur*innen bei der Umsetzung von Maßnahmen für einen nachhaltigen digitalen Wandel ist ebenfalls von entscheidender Bedeutung. Hier ist die öffentliche Hand gefragt. Außerdem sollte diese mit gutem Beispiel vorangehen: Bei Investitionsentscheidungen oder Einkäufen im Rahmen des öffentlichen Beschaffungswesens müssen digitale und ökologische Anforderungen gut aufeinander abgestimmt werden. Öffentliche Auftraggeber sind mit ihrer Beschaffungsmacht in einer einzigartigen Position, um Veränderungen zu beschleunigen. Ein strategischer Ansatz kann viel mehr bewirken.
Die Zwillingstransformation kann nicht ohne eine starke Beteiligung der Zivilgesellschaft stattfinden. Organisationen der Zivilgesellschaft können die Umweltauswirkungen digitaler Produkte prüfen, das Bewusstsein für Investitionen in umweltfreundliche digitale Technologien und Dienstleistungen schärfen und Möglichkeiten für Bürger*innen schaffen, sich an umweltfreundlichen digitalen Initiativen zu beteiligen. Sie spielen eine wichtige Rolle bei der Förderung der digitalen Kompetenz, indem sie sicherstellen, dass die Bürgerinnen und Bürger wissen, wie sie digitale Technologien auf nachhaltige Weise nutzen können. Schließlich spielen sie auch eine Rolle bei der Politikgestaltung: So haben wir beispielsweise mehrere Nichtregierungsorganisationen eingeladen, die Arbeit des bereits erwähnten Industrieforums zu unterstützen, das die Kommission bei der Umsetzung ihrer Industriestrategie begleitet. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die Ansichten der Zivilgesellschaft bei der Formulierung von Strategien und politischen Maßnahmen Gehör finden und berücksichtigt werden.
Aufgrund seines enormen wirtschaftlichen Potenzials wird es vor allem der Privatsektor sein, der den digitalen Wandel vorantreibt und in hohem Maße von technologischen Innovationen profitiert. Sehen Sie eine ähnliche Entwicklung für den grünen Wandel? Kann und wird der Privatsektor auch hier eine Vorreiterrolle spielen und wenn ja, wie? Welchen Weg werden die Europäische Kommission und die lokalen Regierungen einschlagen müssen – Vertrauen auf das Engagement und die Verantwortung der Unternehmen oder mehr Regulierung und Anreize?
Ich glaube, man braucht beides. Erstens hilft es, wenn es ein klares Ziel für die Industrie gibt. Die Europäische Kommission konzentriert sich derzeit darauf, den Privatsektor zu ermutigen, sich auf ehrgeizige grüne Ziele zu verpflichten, wie zum Beispiel den europäischen Green Deal, der eine Reduzierung der Emissionen um 55 Prozent bis 2030 vorsieht. Dies spiegelt sich auch in unseren Investitionsprogrammen wider. Das Programm InvestEU zum Beispiel soll private Investitionen in den grünen Wandel erleichtern. Zweitens: Dieses Ziel muss erreichbar sein. Deshalb müssen wir auch Organisationen aktiv unterstützen, die vielleicht nicht über alle notwendigen Ressourcen – sei es finanzieller oder personeller Art – verfügen, um den Wandel aus eigener Kraft zu schaffen. Unsere Daten zeigen, dass KMUs in Europa bei der digitalen Transformation hinter größeren Unternehmen und in einigen Fällen auch hinter anderen Regionen der Welt zurückliegen. Das Enterprise Europe Network ist in dieser Hinsicht von entscheidender Bedeutung. Das Netzwerk hilft KMUs bei der digitalen und grünen Transformation und unterstützt das Matchmaking zwischen Unternehmen in ganz Europa. Im kommenden Jahr wird die Kommission eine Reihe von Matchmaking-Veranstaltungen für Anbieter digitaler Lösungen organisieren, um KMUs bei ihrem digitalen Wandel zu helfen und innovative europäische Unternehmen zu unterstützen. Ziel ist es, das Bewusstsein für digitale Lösungen „made in Europe“ zu schärfen, die den spezifischen Bedürfnissen von KMUs in verschiedenen industriellen Ökosystemen gerecht werden können.
Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine sieht sich Europa mit steigenden Energiekosten konfrontiert. Dies hat zu einem schwierigen wirtschaftlichen Klima für Millionen europäischer Unternehmen geführt. Investitionen in grüne Technologien, die Energie sparen, sind heute nicht nur eine kluge Geschäftsentscheidung, sondern auch eine Entscheidung über das mittel- und langfristige Überleben eines Unternehmens. Unsere Aufgabe als Behörden ist es, Anreize und finanzielle Unterstützung für grüne Investitionen zu bieten, um den Wandel auch für KMUs voranzutreiben und Anbietern grüner und digitaler Lösungen zu helfen, ihre Lösungen auf EU-Ebene zu verbreiten. Wie ich bereits erwähnt habe, ist eines der Instrumente, um Investitionen in nachhaltige Projekte und Aktivitäten zu lenken, die Schaffung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen, der als EU-Taxonomie bekannt ist. Diese EU-Taxonomie wird durch die EU-Resilienzfazilität ergänzt. Die Fazilität soll dazu beitragen, die Auswirkungen der Pandemie abzumildern und den Wiederaufschwung in Europa zu unterstützen, indem sie den ökologischen und digitalen Wandel durch Investitionen in Höhe von insgesamt mehr als 720 Mrd. EUR beschleunigt. Die Kombination aus Regulierung, Anreizen und der Gewährleistung, dass niemand während des Wandels zurückgelassen wird, ist die beste Chance, die wir haben, um die Entwicklung hin zu einem grünen Europa, das für das digitale Zeitalter gerüstet ist, zu beschleunigen.
In unserer Studie aus dem Jahr 2021 haben wir festgestellt, dass es den meisten Bürger*innen schwerfällt, die Auswirkungen und Entwicklungen der Zwillingstransformation zu verstehen. Sie sind sich nicht sicher, wie diese beiden Megatrends miteinander interagieren, wer die relevanten Akteur*innen sind und welche Maßnahmen der Zwillingstransformation am meisten nutzen würden. Welche Rolle spielt Bildung für den Erfolg der Zwillingstransformation?
Der grüne UND digitale Wandel ist ein komplexes, aber notwendiges Unterfangen. Bildung ist der Schlüssel. Die Bürger*innen müssen verstehen, wie sich die Zwillingstransformation auf ihr Leben auswirkt, wie sie am besten darauf reagieren und wie sie fundierte Entscheidungen treffen können. Wir müssen auch dafür sorgen, dass der Privatsektor über die notwendige Anzahl qualifizierter Menschen verfügt, um Innovationen und Investitionen für die Zwillingstransformation zu tätigen. Derzeit berichten mehr als 75 Prozent der Unternehmen in der EU über Schwierigkeiten, Arbeitskräfte mit den erforderlichen Qualifikationen zu finden. Statistiken zeigen, dass nur 37 Prozent der Erwachsenen regelmäßig an Weiterbildungsmaßnahmen teilnehmen. Laut dem Index für die digitale Wirtschaft und Gesellschaft verfügen 40 Prozent der Erwachsenen in Europa nicht über grundlegende digitale Kompetenzen – ein gravierender Mangel.
Die Kommission hat vorgeschlagen, 2023 zum Europäischen Jahr der Kompetenzen auszurufen, um dem lebenslangen Lernen durch verstärkte Investitionen in die Aus- und Weiterbildung der europäischen Arbeitskräfte neue Impulse zu verleihen. Dies wird dazu beitragen, Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt in Einklang zu bringen und Menschen aus Drittländern anzuziehen, die über die in der EU benötigten Qualifikationen verfügen. Natürlich spielen auch Initiativen der Industrie eine wichtige Rolle, insbesondere im Bereich der Aus- und Weiterbildung. Eine solche von der Kommission unterstützte Initiative ist der Pakt für Kompetenzen, der darauf abzielt, öffentliche und private Organisationen bei der Weiterbildung und Umschulung zu unterstützen, damit Europa über die für den Wandel erforderlichen Kompetenzen verfügt. Bisher haben sich mehr als 700 Organisationen beteiligt, und es wurden 12 groß angelegte Partnerschaften in strategischen Sektoren gegründet, die sich verpflichtet haben, bis zu 6 Millionen Menschen zu qualifizieren.
Nach diesen wertvollen Einblicke in die Pläne der Europäischen Kommission für eine grüne und digitale Zukunft Europas: Gibt es etwas, das wir Sie nicht gefragt haben, das Sie uns aber gerne sagen würden?
Wir befinden uns mitten in der größten geopolitischen und damit auch wirtschaftlichen Krise, die Europa seit Jahrzehnten erlebt hat. Unsere Aufgabe als Kommission ist es, alles in unserer Macht Stehende zu tun, um die Millionen KMUs bei der Bewältigung der Krise zu unterstützen, ohne dabei das längerfristige Ziel aus den Augen zu verlieren, sie beim beschleunigten digitalen und grünen Wandel zu unterstützen. Wir müssen diesen Übergang mit klaren Zielen, eindeutigen Regeln und finanziellen Anreizen vorantreiben und gleichzeitig sicherstellen, dass niemand zurückgelassen wird und dass die Zwillingstransformation zu einem nachhaltigeren Europa führt.

„We need a measurement method for positive environmental impacts of green digital technologies.“

An important part of the 2022 Strategic Foresight Report of the European Commission is the Twinning of the digital and green transition. Both are at the top of the European Commission’s political agenda and their interplay will have massive implications for the future. Their success will also be key for achieving the United Nations Sustainable Development Goals. At the same time, the digital transition progressed with only limited considerations regarding sustainability and has some severe adverse side effects on sustainability as well. What are the next important steps the European Commission plans on taking to diminish these adverse effects and to ensure that the digital transition enhances ecological sustainability and the green transition?
We, at the European Commission, are fully convinced that digital technologies are an essential element of the green transition. It is important to be clear on this. In the energy sector, they enable deployment of renewable energy technologies at scale, balancing the grid more efficiently with virtual energy storage systems. In mobility, digital technologies allow for the use of electric vehicles, and deploy the necessary charging infrastructure. In our homes, smart heating solutions can reduce energy consumption through a network of sensors, smart meters, and energy management solutions. Finally, in agriculture, new business models enabled by digital technologies allow farmers to share farming equipment, reducing costs and production emissions. The sectoral examples are clear. With that said, it is true that digital technologies can produce significant carbon footprints, highlighting the need for the digital economy, like all other sectors, to develop sustainability. The European Commission is very much committed to these objectives, as reflected in its 2023 Work Programme. Two of the programme’s key aims, that is, building the Green Deal, and ensuring that Europe is fit for the digital age, are not aligned by default. It is important to tackle the most pressing challenges, while staying on course for the long-term.
To ensure the European industry transitions in a sustainably way, while maintaining competitiveness and remaining resilient within global value chains, the Commission has implemented and proposed a wide range of initiatives. The EU aims to facilitate sustainable investments through a taxonomy for sustainable economic activities, which will play an important role helping the EU scale up sustainable investments by providing companies, investors and policymakers with appropriate definitions for which economic activities can be considered environmentally sustainable. Alongside this taxonomy, eco-design rules are in place ensuring electronics comply to energy efficiency requirements. For example, the Commission’s eco-design regulation on servers and data storage products are expected to result in electricity savings of up to 9TWh/year, the equivalent of the annual electricity consumption of Estonia in 2014. It will also lead to greenhouse gas emission reductions of up to 3 Mton CO2 per year. Looking to the future, the Commission’s European circular economy action plan will help reduce e-waste, such as seen with the regulation for a Europe-wide common charger for handheld electronics by 2024. Currently, less than 40% of all e-waste in the EU is recycled. This is one small part in the European Union’s ambition to create a Single Market that serves as the gold standard for sustainable technology, innovation, and growth.
As of right now the main narrative is about the impact the digital sector has on the green transition – be it the adverse effects of electrical waste, energy consumption of digital devices, heightened consumerism etc. or how digital technologies could play a key role in achieving climate neutrality. But how can and will the pursuit of the green transition by the European Commission also transform the digital sector? What kind of actions is the European Commission able and willing to take to ensure that the digital transition progresses way more sustainably than it did in the past?
The green transition is a must for all sectors without exceptions, the digital ecosystem included. The Commission adopts an inclusive approach, helping align actors towards actions for climate neutrality, while ensuring that there is a just transition. These two elements must be balanced and require a variety of stakeholders cooperating on common issues to be realised. In this spirit, the Commission established the European Industrial Forum. The forum consists of industry, Member States and policymakers, all working to help shape specific transition pathways for each sector of the EU economy, or as we call them ‘industrial ecosystem’. The transition pathways identify gaps, synergies, and areas for cross-border cooperation to accelerate the sustainable and digital transition. The initiative aims to help SMEs, the backbone of European industry, to realise the transition while remaining competitive and resilient. The digital sector is impacted by each transition pathway, which outline concrete future action sectors can take to decarbonise and remain competitive. On a more granular level, to support European SMEs, the Commission has specific initiatives, for example with services delivered by the European Enterprise Network (EEN). The network provides dedicated services to individual SMEs in need of assistance to realise the twin transition.
Beyond these pathways, I would like to highlight two initiatives which are relevant in this transition context. The first one is about measurement. Compared to measuring the negative impact of electronic products, measuring the positive environmental impact of digital technologies is not straightforward. We need a robust method to calculate the net impact of green digital technologies on the environment and climate. Establishing new indicators can help assess the positive impact of initiatives, such as seen with the European Green Digital Coalition (EGDC). This industry-led initiative, supported by the Commission and the European Parliament, aims to do exactly that: invest in the development and deployment of greener digital technologies and develop a standard way to measure their net impact.When focusing on the digital economy, we also need to address the supply chains and input materials. The Critical Raw Materials Act, which the Commission has planned to put forward in 2023, aims to ensure the supply of raw materials, many being essential for the digital transition, and takes into account sustainability requirements. The EU has a huge responsibility to make the transition happen. It is also clear that this transformation of the digital sector calls for a coordinated response from governments, the private sector and wider society to ensure Europe transitions to a resource efficient and competitive economy.
The European Commission says that the digital transition will be spearheaded mainly by the private sector due to its huge economic potential, but that state and civil society engagement will be necessary as well to harness its benefits for greening and to limit its harmful effects. Can you elaborate on that: What can the government as well as civil society do to support the twinning effects of these two transitions?
The digital transition is a challenge, however if undertaken correctly offers significant economic opportunities that will benefit society broadly. The public sector plays a role in ensuring the transition is sped up and delivers for all segments of society. As for the EU, I already mentioned some of our strategies and initiatives. What is true for the EU and the Commission, is also valid for all levels of governments across the EU. In particular, governments have to make sure that strategies are in place, and that there is a good level of multi-stakeholder coordination.This means establishing the appropriate framework for investment, making sure sustainability requirements and standards for products and services are well defined, and complied with. This nurtures a good business environment, with clear legal requirements and appropriate incentives. It is also key to support economic actors in implementing actions for the sustainable digital transition. Government does indeed have a role to play. Finally, the public sector should lead by example: in their investments decisions or purchases, through public procurement, digital and green requirements must be well coordinated. Public buyers are in a unique position to leverage their purchasing power to accelerate these transitions. With a strategic approach, the impact can be much higher.
The twin transition cannot happen with the strong participation of civil society. Civil society organisations can scrutinise the environmental impact of digital products and services, raise awareness about investing in green digital technologies and services, and create opportunities for citizens to get involved in green digital initiatives. They have a huge role in promoting digital literacy, ensuring that citizens understand how to use digital technologies in a sustainable manner. Finally, they also have a role in governance: for example, we have invited several NGOs to support the work of the aforementioned Industrial Forum, which supports the Commission in the implementation of its Industrial Strategy. This ensures that the views of civil society can be raised and taken into consideration when formulating strategy and policy.
Due to its huge economical potential the private sector will mainly spearhead the digital transition and also benefit largely from technological innovations, which is one of the main reasons it continues to invest in the digital transition. Do you see a similar development regarding the green transition? Can and will the private sector spearhead this transition as well and if so, how? What path will the European Commission as well as local governments need to pave: Reliance on self-commitment and responsibility of corporations or more regulations and incentives?
I believe you need both. Firstly, it helps if there is a clear target for industry. The European Commission is currently focusing on encouraging the private sector to commit to ambitious green goals, such as the European Green Deal, which calls for a 55% cut in emissions by 2030. And our financial programmes reflect this. The InvestEU programme for example aims at leveraging private investment for the green transition. Second, this target must be achievable. That is why we will also need to actively support organisations that may not have all the necessary means – either financially, or human resource wise – to complete the transformation on their own. Our data shows that European SMEs are lagging behind with the digital transition when compared to bigger companies, and in some cases behind other regions of the world. The Enterprise Europe Network is critical in this respect. The network helps traditional SMEs in their digital and green transition and supports matchmaking for companies across Europe. Next year, the Commission will launch a set of matchmaking events for digital solution providers to help SMEs in their digital transition and support innovative European companies. The idea is to raise awareness about ’made in Europe’ digital solutions that can answer the specific needs of SMEs in different industrial ecosystems.
Europe has been subject to raising energy costs due to the Russian aggression of Ukraine. This has created a dire economic environment for millions of European companies. Today, investing in green technologies that save energy is not only a wise business decision, but a decision between surviving as a business or not in the medium to long term. Our role as public authorities is to provide incentives and financial support for green investments in order to drive the transition also for SMEs and to support green and digital solutions providers in scaling up their solutions at EU level. As I mentioned earlier, one tool to direct investments towards sustainable projects and activities, is through the establishment of the framework to facilitate sustainable investments, known as the EU Taxonomy. This EU Taxonomy is complemented by the EU post-COVID Recovery and Resilience Facility. The facility aims to help mitigate the effects of the pandemic and support the European bounce-back by accelerating the green and digital transitions, through investments totalling more than €720bn. The combination of regulations, incentives, and ensuring no one is left behind during the transition, is the best chance we have at accelerating towards a green Europe fit for the digital era.
We found in our 2021 study that most citizen’s find it hard to understand the impact and development of the twin transition. They are not sure how those two mega trends interact with each other, who the stakeholders are and what actions would benefit the twin transition the most. What role does education play for the success of the twin transition?
The green and digital transition is a complex but necessary undertaking. Education is key. Citizens have to understand the impact of the twin transition on their lives, how to best take action, and how to make informed decisions. We also need to ensure that the private sector has the necessary amount of skilled people to innovate and invest in the twin transition. Currently more than 75% of companies in the EU report difficulties in finding workers with the necessary skills. Statistics indicate that only 37% of adults undertake training on a regular basis. There is a severe lack people with digital skills: according to the Digital Economy and Society Index, 40% of adults in Europe lack basic digital skills.
The Commission has proposed to make 2023 the European Year of Skills, to give a fresh boost to lifelong learning by increased investments in training and upskilling in the European workforce. This will help match supply and demand in the job market, and by attracting people from third countries which the skills needed in the EU. There is of course a huge role also for industry driven initiatives, particularly in the field of upskilling and re-skilling workers. One such initiative supported by the Commission is the Pact for Skills, which aims to support public and private organisations with upskilling and reskilling, so Europe has the skills needed for the transition. So far, more than 700 organisations have signed up, and 12 large-scale partnerships in strategic sectors have been set up with pledges to help upskill up to 6 million people.
After these valuable insights into the European Commissions’ plans for ensuring a green and digital future for Europe: Is there anything we haven’t asked you, but that you would like to share with us?
We are in the middle of the biggest geopolitical and, consequently, economic crisis Europe has witnessed in decades. Our role, as Commission is to do everything we can now to support the millions of SMEs in surviving the crisis, while also not losing sight of the longer term goal of supporting them in the accelerated digital and green transition. We must nurture this transition with clear targets, explicit rules and financial incentives, while ensuring that no-one is left behind and that twin transition results in a more sustainable Europe.