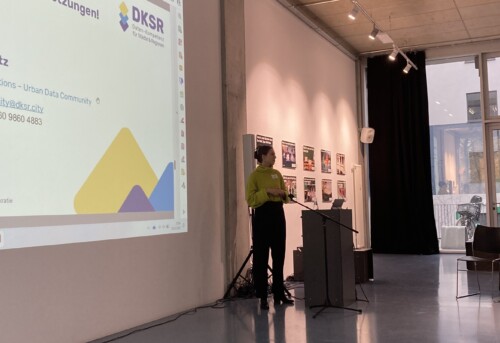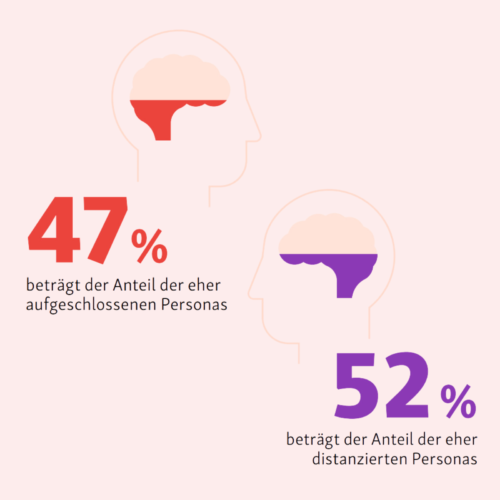AG-Blog | Zwischen offenen Daten und Datensilos – Wieso braucht es eine Datenstrategie?
Datenmanagement in der Wissenschaft sowie Chancen datenbasierter Lösungsansätze im öffentlichen Sektor beschäftigten die AG Datendemokratie bei ihrer letzten Sitzung. Dabei ging es besonders um Strategien für den Umgang mit den größten Herausforderungen.
Berlin. Jeden Tag produzieren wir nahezu unvermeidlich eine erhebliche Menge an Daten. Wenn eine größere Menge an Beteiligten mit diesen Daten umgehen soll, ist es unvermeidlich, praktikable Lösungen für das Teilen der Daten zu finden. Es geht darum, sie verantwortungsbewusst zur Verfügung zu stellen, innovative Analysen durchzuführen und Daten so letztlich für evidenzbasierte Entscheidungen zu nutzen. Wer auf diesem Feld bereits Vorreiter ist, welchen aktuellen Herausforderungen man begegnen kann und wie Datenintermediäre gestaltet werden können, um bei diesen Herausforderungen zu helfen – darum ging es bei der letzten Sitzung der AG Datendemokratie, die im CLB Berlin stattfand.
Datenmanagement in der Wissenschaft

Was sind die Vorteile beim Teilen von Daten? In ihrem Impuls präsentierte Henriette Senst, Bibliotheksdirektorin des Deutschen Archäologischen Instituts, was die Forschung dem Public Sector hinsichtlich des Teilens von Daten voraushat. Als Praxisbeispiel hatte sie das Projekt „EcoDM – Ökosystem Datenmanagement“ mitgebracht, das von 2019 bis 2022 gelaufen war. Ziel des Projekts sei es gewesen, exzellente vertrauenswürdige Daten für Fragestellungen aller Art zu vereinen und eine Datenlandschaft zu schaffen, die durch die Zusammenarbeit von Wissenschaft, öffentlichem Sektor, Wirtschaft, Gesellschaft und Privatpersonen geformt wird.
Die Umsetzung erforderte die Zusammenarbeit hinsichtlich Teilhabe, Ethik, Rechtssicherheit, Standardisierung, Interoperabilität und Wettbewerbsfähigkeit.
Zunächst habe man in dem Projekt notwendigen Rahmenbedingungen dafür festgelegt, um Daten systematisch und FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable, also auffindbar, zugänglich, interoperabel und nachnutzbar) aus und in unterschiedlichen Datenräumen nutzen und teilen zu können, so Senst. Das Projekt konzentrierte sich auf die Bereiche Wissenschaft, öffentlicher Sektor, Wirtschaft und Qualifizierung. Letztendlich wurden als Ergebnis 26 Empfehlungen in fünf Kategorien für den Public Sector erarbeitet, darunter:
- Infrastruktur und Ressourcen: Eine verbesserte Auffindbarkeit von dezentralen Ressourcen und die Nutzung bestehender Metadatenportale sowie eine langfristige Finanzierung und angemessene Ausstattung von GovData seien wichtig.
- Rechtliche Rahmenbedingungen: Open Source müsse in das Vergaberecht. Sein Einsatz sowie offene Standards und offenen Schnittstellen müssten als Vergabekriterien gelten.
- Qualifizierung, Karrierewege und Kompetenzaufbau: Der Schulungs- und Fortbildungsbedarf sollte immer wieder auf die strategischen Ziele und tatsächlichen Bedürfnisse der jeweiligen Einrichtung ausgerichtet werden.
- Kulturwandel: Datenmanagement müsse in der Gesamtstrategie in jedem Leitfaden, Regelwerk oder Strategiepapier als Handlungsfeld klar benannt werden.
- Vernetzung und Zusammenarbeit: Die Zusammenarbeit an Schnittstellen sollte gestärkt werden, indem der Public Sector als aktiver Teilnehmer bei Forschungsprojekten oder konkreten Umsetzungsprojekten mit Open Data fungierte. Dazu müssten Anreize geschafft werden
Weitere EcoDM-Vorschläge für den übergreifenden Bereich wurden in 31 Empfehlungen gruppiert und umfassen sechs Themenfelder: Harmonisierung und Kooperation, Anreizsysteme und Kompetenzentwicklung, ethische Grundsätze und öffentliches Interesse, Vertrauenswürdigkeit, Vermarktung und die Wirkung von Open-Data-Strategien. Alle Empfehlungen finden sich in aller Ausführlichkeit in der , welche die Ergebnisse des Projekts zusammenfasst.
Chancen datenbasierter Lösungsansätze für die Daseinsvorsorge

Eva Schmitz, Beraterin beim „Daten-Kompetenzzentrum Städte und Regionen“ (DKSR), stellte im nächsten Impuls den aktuellen Stand des Datenaustauschs in der Verwaltung von Städten und Kommunen und zeigte dabei vor allem die Herausforderungen sowie die Chancen auf. Durch datenbasierte Lösungen könnten urbane Lebensräume und kommunale Daseinsvorsorge für die Bürger*innen gemeinwohlorientiert, sicher und nachhaltig gestaltet werden. Das DKSR hat die Mission, datenbasierte Lösungen flächendeckend einzusetzen, indem es eine offene urbane Datenplattform, Beratung und Vernetzung in seiner Community bereitstellt. Die Plattform diene dazu, Datensilos aufzubrechen und Daten effizienter zu nutzen. Außerdem vernetze, harmonisiere und verarbeite die Plattform Daten, um diese schnell und effizient auffindbar, sicher teilbar und strukturiert nutzbar zu machen. Sie ist Open Source. „Wir nutzen hauptsächlich Echtzeit-Daten aus den Bereichen Umwelt und Verkehr, um datenbasierte Lösungen anzubieten. Ein gutes Beispiel ist das KUDOS-Dashboard für Mikromobilität aus Köln, das anzeigt, wie und mit welcher Dynamik sich Sharing-Angebote von Mobilitätsanbietern in bestimmten Gebieten der Stadt verteilen“, erläuterte Schmitz Auf dieser Grundlage könne die Stadt Köln die Angebote bewerten und bestimmen, wo ein erhöhtes Angebot sinnvoll ist, und wo zum Beispiel Geofencing erforderlich sei.
Zehn Städte arbeiten bereits mit der Plattform und können (mit Unterstützung) eigene Anwendungen darauf aufsetzen. In vielen Bereichen wie beim Wasser, der Mobilität, der Sicherheit, der Energie und der Luft könne durch die Auswertung der Daten eine Prozessoptimierung stattfinden, die zu besserer Daseinsvorsorge führt. „Allerdings benötigt der Einsatz solcher datenbasierten Lösungen das Engagement der Städte, auch um Testphasen aktiv zu gestalten“, so Schmitz.
Die Zukunft des Datenschutzes: Anonymisierung, Anreize für Datenverteilung und Datentreuhänder
Frederick Richter, Vorstand der Stiftung Datenschutz, beschäftigte sich im abschließenden Impuls mit der Frage, wie ein langfristiger Umgang mit dem Thema Daten gestaltet werden könne.
Wir brauchen nicht nur eine Datenschutzstrategie, sondern auch eine Datennutzstrategie, um Ziele wie Datenkompetenz, Datenkultur und Datenteilung zu erreichen
Es bestehe ein großer Bedarf an Anreizen dafür, Daten zu teilen. Dazu seien Standards zur Anonymisierung und Festlegungen zur Datentreuhand besonders wichtig. Denn die Forderung einer Datenteilungspflicht sei nicht realistisch. Das Aufbrechen von Datenmonopolen marktdominanter Unternehmen und die Förderung von Open Data sollte in Richters Augen nicht nur in der Verwaltung, sondern auch in der Wirtschaft vorangebracht werden. Momentan seien jedoch auch viele negative Anreize vorhanden, wie hohe Anforderungen an Verantwortliche und Unsicherheiten im Hinblick auf die Anonymisierung. Hier seien Anonymisierungstechniken und verbindliche Standards nötig.

Richters Empfehlung zum Abschluss: „Wir müssen Datentreuhand als eine Möglichkeit zur Förderung der Teilhabe an der wirtschaftlichen Datenverwertung und zur Einschränkung der Stellung großer Plattformbetreiber prüfen.“ Datentreuhand werde als System werde bereits von verschiedenen Akteuren gefordert, darunter die Bundesregierung sowie die CDU/CSU- und die SPD-Fraktion. Das freiwillige Teilen von Daten würde dann durch vertrauenswürdige Datenräume und Datentreuhänder gefördert, den Schutz persönlicher und personenbezogener Daten sicherstellen und den Austausch von nicht-personenbezogenen Datensets ermöglichen. Auch der Data Governance Act der EU fordere dies: Er will den freiwilligen Datenaustausch stärken werden und Regeln für Datenintermediäre, Treuhandstrukturen und Datenvermittlungsdienste festlegen. Die Herausforderungen dabei seien vor allem eine einheitliche Datenschutzregelung und die Vermeidung von Komplexitätssteigerungen.
Die Sitzung hat gezeigt, dass das Teilen von Daten ein wichtiger Bestandteil einer datendemokratischen Gesellschaft ist. Es ist notwendig, verantwortungsbewusste Lösungen zu finden, um Daten so effektiv wie möglich zu nutzen. Doch noch besteht Raum für Fortschritte und mehr Zusammenarbeit – das haben die Ergebnisse des EcoDM-Projekts und die datenbasierten Lösungsansätze vom DKSR eindrücklich vorgeführt.