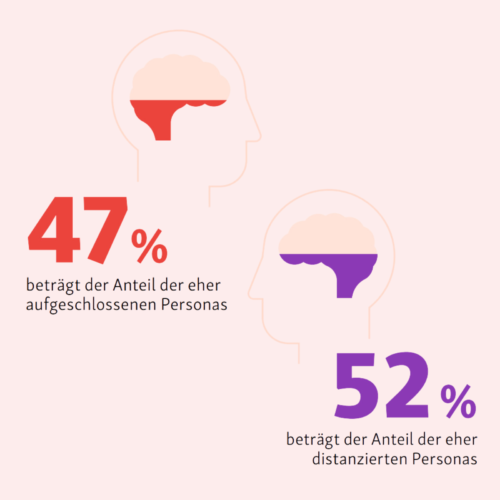Digital Future Challenge
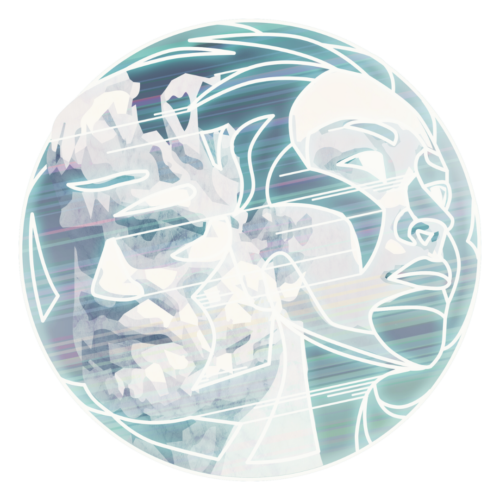
Die Digital Future Challenge ist ein gemeinsames Projekt der Deloitte-Stiftung und der Initiative D21, um die Verantwortung von Unternehmen im und durch den digitalen Wandel zu beleuchten. Mit ihrem Handeln in der digitalisierten Welt schaffen Unternehmen zunehmend Innovationen und gesellschaftliche Veränderungen. Diese bringen neben Chancen auch Risiken mit sich, von denen viele noch nicht ausreichend bedacht wurden und welche die unternehmerische Verantwortung um eine Dimension erweitern: Corporate Digital Responsibility (CDR). Mit der DFC soll ein Bewusstsein für diese Thematik in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft geschaffen und das Thema aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet werden. Denn es bedarf einer gesamtgesellschaftlichen Anstrengung, um das Thema nachhaltig zu verankern.

Die Challenge ruft bundesweit Studierende auf, anhand konkreter Beispiele aus der Unternehmenspraxis Prinzipien und Eckpunkte für ein verantwortliches Handeln von Unternehmen in der digitalen Welt zu erarbeiten. Dazu treten interdisziplinäre und diverse Projektteams in den Wettbewerb um die besten, kreativsten und nachhaltigsten Ideen. Unternehmen und Organisationen aus der D21-Mitgliedschaft und darüber hinaus reichen dafür Usecases aus der Praxis ein.