AG-Blog | Bildungsrevolution digital: Wo stehen wir, wo müssen wir hin?
Die digitale Transformation in der Bildung ist längst in vollem Gange, doch stehen wir noch immer vor entscheidenden Herausforderungen. Die AG Bildung lud dazu ein, den aktuellen Stand der Digitalisierung im Bildungssystem zu analysieren und visionäre Ansätze für die Zukunft zu entwickeln.
Berlin/virtuell. In der letzten Sitzung der AG Bildung des Jahres blickten die Teilnehmenden zusammen mit Expert*innen aus Forschung und Praxis auf den Ist-Zustand der schulischen Bildung – in Sachen Digitalkompetenzen, aber auch darüber hinaus – und wagte einen Blick nach vorne: Welche Zukunftsvisionen gibt es für digitale Bildung? Wie kann innovative Bildung aussehen?
Zukunftsvisionen: Wo kann es hingehen?

Thomas Spahn, Auslandsdienstlehrkraft und ehemaliger kommissarischer Schulleiter der Deutschen Internationalen Schule im Silicon Valley (GISSV), gab genau hierzu einen Einblick aus der Praxis. Bei seiner Arbeit sei es ihm besonders wichtig, Schüler*innen ausreichend auf eine erfolgreiche reflektierte Teilhabe an der Zukunft vorzubereiten. Die GISSV ist eine anerkannte Deutsche Auslandsschule und wurde vor 25 Jahren für Kinder deutschsprachiger Fachkräfte im Silicon Valley errichtet. Inzwischen ist die Schule eine internationale Begegnungsschule, an der Abitur und das High School Diplom verliehen werden. Aus seiner Erfahrung habe er drei Bedingungen für eine gute Schule mit innovativer Bildung abgeleitet:
- Partizipation (z. B in Form von Freiwilligenarbeit, Club Culture oder Gremienarbeit)
- Projektlernen (um fachliche und überfachliche Kompetenzen miteinander zu verbinden)
- Prüfungsformate (Fokus auf alternativen Formaten & Projektarbeit)
Die GISSV setze zum Beispiel auf alternative Prüfungsformate, bei denen die Schüler*innen eigene Projekte wie Podcasts, Blogs oder auch kreative Brettspiele ausarbeiten. Diese „Complex Assignments“ ersetzen in einigen Fächern bis zu 50 % der Klassenarbeiten und umfassen meist verschiedene Wahlmöglichkeiten, um die individuellen Vorlieben und Talente der Schüler*innen miteinzubeziehen. Zum Abschluss werden die erstellten Projekte gemeinsam in der Klasse diskutiert, um differenziertes Feedback zu erhalten. Diese Methode hab sich als äußerst beliebt und wirkungsvoll bei den Schüler*innen erwiesen.
Ein Startup-Projekt als innovatives Prüfungsformat
Als konkretes Beispiel stellte Spahn das GISSV Startup-Projekt vor. Dabei identifizieren die Schüler*innen der 10. Klassen zunächst reale Problemstellungen, die mittels KI und Deeper Learning gelöst werden könnten. Im nächsten Schritt entwickeln sie konkrete Lösungsansätze und bereiten diese als Pitch vor. Die Schüler*innen lernen so, interdisziplinär zu arbeiten, da das Projekt die Fächer Informatik, Economics und Ethik gleichermaßen miteinbezieht. Auch die innovative Umgebung im Silicon Valley werde dabei aktiv miteingebunden. Zusätzlich halten Elternteile und anderer Expert*innen Vorträge und Workshops.
In einer zweiten Phase des Projekts arbeiten die Schüler*innen dann kreative Konzepte aus, die zunächst in mehreren Feedbackrunden gemeinsam besprochen werden. Anschließend haben sie die Möglichkeit, ihre konzipierten Algorithmen und Apps tatsächlich selbst zu entwickeln. Zum Abschluss werden die Projekte bei einer Nachstellung des Formats „Shark Tank“ der Schulöffentlichkeit sowie einer Jury bestehend aus echten Gründer*innen vorgestellt und die die besten Projekte prämiert.
Die Schüler*innen haben bei dem Projekt nicht nur mit, sondern auch ganz viel über KI gelernt. Der interdisziplinäre Ansatz integriert Expert*innen, und auch Feedback spielt eine entscheidende Rolle. Das wirkt systemisch und wird auch auf andere Fächer ausgeweitet. Das Projekt läuft seit vielen Jahren und hat bereits erfolgreiche Gründer*innen hervorgebracht.
Sprunginnovationen im Bildungsbereich
Im Anschluss beleuchteten Johannes Koska und Jelka Seitz von der Bundesagentur für Sprunginnovationen (SPRIND), was es braucht, um Bildung wirklich revolutionär zu transformieren. Sprunginnovationen sind Innovationen, die Lösungen für die großen technologischen, sozialen und ökologischen Probleme unserer Zeit finden. Bildung sei, so die beiden Expert*innen, die Mutter aller Sprunginnovationen und die wichtigste Ressource unseres Landes.

Man könne Sprunginnovationen in technologische sowie systemische Innovationen unterteilen. Eine technologische Sprunginnovation wie zum Beispiel ChatGPT füge etwas Neues von außen in einen bestehenden Markt hinzu und löse dabei eine Transformation im „Außen“ aus. Eine systemische Sprunginnovation verändere ein bereits bestehendes System grundlegend, um sich z. B. durch eigene Transformation der Transformation im Außen anzupassen. Für das Bildungssystem heißt das: Es muss sich grundlegend als System verändern – es brauche eine systemische Sprunginnovation, weil technologische Sprunginnovationen das Außen vollkommen verändert haben.
In der Praxis zeige sich, dass viele Paradigmen zwischen der Welt des Staates und der Welt der Innovationen stünden. Der Staat bewahre oft, was funktioniert, während die Innovation lernt, was funktioniert. Das liege natürlich auch daran, dass der Staat Recht und Stabilität bringen soll und die Welt der Innovationen für Fortschritt steht. Das System müsse daher zunächst in die Lage versetzt werden, Innovationen und Veränderungen zu ermöglichen. Dazu müsse unter anderem ein Weg gefunden werden, Regeln und Vorgaben anders auszulegen.
Ziel der SPRIND ist es daher, langfristig das beste von beiden Seiten miteinander zu verbinden. Am Ende soll der Staat als Innovator fungieren. Dazu will sie innovative Denker*innen aus verschiedenen Bereichen zusammenbringen und in ihren Projekten unterstützen:
Wir wollen mit der SPRIND im Tech-Bereich eine neue Gründerzeit möglich machen, indem der Staat dieses innovierende Element mitgibt. Wir glauben, dass dies auch Teil einer neuen Vision von Bildung sein muss.

Die Art, wie die SPRIND reagiert, könne auch auf den Bildungsbereich übertragen werden. Das Bildungssystem in Deutschland müsse sich verändern, um mit Innovationen angemessen umgehen zu können. Zwar gebe es schon viele gute Initiativen und Konzepte, diese müssten sich aber erst noch richtig verbreiten und ihren Weg in die Praxis des Systems finden. Die SPRIND blicke daher auf technologische Lösungen sowie auf die Frage, wie Bildung als Ganzes organisiert sein müsse, um zukunftsfähig zu bleiben. Aktuell beschäftigt sie sich mit der Auswirkung des AI-Acts auf den Bildungsbereich:
Was bedeutet die KI-Verordnung für die Bildung? Wie kann man sie mit Leben füllen und als Chance sehen, sie im Sinne der Bildungsziele zu nutzen? Hier wollen wir dabei helfen, dass die Verordnung den bestmöglichen Impact haben kann und nicht verhindernd wirkt.
Es müsse darauf geachtet werden, die besten Rahmenbedingungen zu gestalten, damit KI möglichst gut im Sinne der Pädagogik genutzt werden könne. Die SPRIND identifiziere mit ihrer Bildungsmission weitere Probleme und Lösungswege und unterstütze andere dabei, ihre Transformation hin zu mehr Innovationsfähigkeit umzusetzen. Hilfreich sei dabei vor allem die Zusammenarbeit mit Expert*innen aus der Praxis, in der dann Lösungen entstehen, die dann von allen genutzt werden können.
DigitalPakt Schule: Ein Blick in die Evaluierung

Nach diesem Blick in eine wünschenswerte innovative Zukunft des Bildungssystems ging es im zweiten Themenblock des Tages um seinen Ist-Zustand. Zentral war dabei die Frage: Welche Ergebnisse hat der DigitalPakt Schule bisher erzielt? Dazu präsentierte zunächst Prof. Dr. Birgit Eickelmann einen Blick in dessen Evaluierung. Als Projektleiterin und Co-Leitung der Evaluierung des DigitalPakt Schule, gab sie spannende Einblicke in die Erfolge und Herausforderungen des ersten DigitalPakts, der Ende 2024 auslaufen wird. Die Evaluation geschehe in drei Dimensionen: Zielerreichung, Wirkung und Wirtschaftlichkeit. Aktuell werde aber vor allem die Dimension der Zielerreichung ausgewertet. Folgende Punkte seien bisher als zentral identifiziert worden:
- Alle Landkreise und kreisfreien Städte haben/werden Mittel aus dem Basis-Digitalpakt für schulische Maßnahmen erhalten.
- Es ist eine vermehrte Nutzung digitaler Anzeige- und Interaktionsgeräte festzustellen.
- Auch mobile Endgeräte werden von Lehrkräften und Schüler*innen vermehrt eingesetzt.
- Und, so die ergänzende Auswertung der ICILS-2023-Ergebnisse: Einen deutlichen Anstieg braucht es beim Zugang zu WLAN für Schüler*innen an den Schulen.
Eickelmann griff besonders den Aspekt der Geschwindigkeit der Entwicklungen im System Schule im Vergleich zur Dynamik der Entwicklungen außerhalb von Schule auf. Im internationalen Vergleich sei Deutschland hier nach wie vor eher langsam:
Man sieht, dass die Ausweitung und Weiterentwicklung der pädagogischen Nutzung neuer Technologie weltweit in vielen Staaten und Bildungssystemen deutlich schneller verläuft. Man muss sich daher die Frage stellen, warum wir – wider besseren Wissens – in Deutschland immer noch so unglaublich behäbig und beharrlich sind.
Der Zwischenbericht der Evaluation zum DigitalPakt wird Anfang 2025 veröffentlicht. Der Abschluss der Evaluation ist für Ende 2026 geplant. Dann werden auch die Aspekte der Wirkung und Wirtschaftlichkeit umfangreicher aufgegriffen und ausgewertet.
Schul-IT-Navigator: Digitalisierung im Bildungsbereich als Gemeinschaftsaufgabe
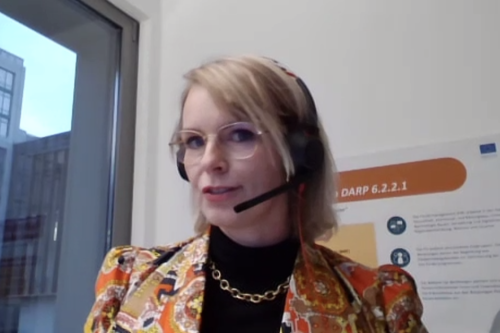
Pauline Seewald kommt aus der Praxis: Sie betreut als Managerin bei PD – Berater der öffentlichen Hand unter anderem Kommunen zum Schwerpunkt Digitalisierung im Bildungsbereich. Über die letzten vier Jahre hat sie gemeinsam mit ihrem Team den Schul-IT-Navigator begleitet. Dessen Ziel ist die nachhaltige Umsetzung von IT-Investitionen in der kommunale Bildungsinfrastruktur. Mittels einer Studie habe man sich zunächst den aktuellen Stand in den Kommunen genauer angeschaut. Das Ergebnis sei wenig überraschend gewesen: Deutschlands Infrastruktur ist nach wie vor ein großer Flickenteppich. Zur Aufarbeitung der Ergebnisse entwickelte man im Anschluss eine Website, auf der das Wissen über die verschiedenen Bereiche der schulischen Digitalisierung kostenfrei zur Verfügung steht.
Die Kommunen stehen jetzt vor der Herausforderung, ihre Aufgaben effizient und effektiv zu gestalten.
Wir haben in vielen Beratungen gesehen, dass die Aufgabenvielfalt aktuell einfach zu groß für die Kommunen ist. Teilweise sind sie daher gar nicht in der Lage, wirklich auf die Bedarfe ihrer Schulen einzugehen.
Eine wichtige Rolle spiele daher der Schul-IT-Support. Dieser soll ein hohes Service- und Supportniveau sicherstellen und dabei möglichst effizient und effektiv agieren. In der Realität sehe das derzeit oft noch anders aus. Durch den Einsatz des „Werkzeugkoffers“ aus dem Schul-IT-Navigator könnten Kommunen ihre Supportstruktur deutlich aufwandsärmer gestalten, so Seewald. Die Digitalisierung von Schulen sei eine Gemeinschaftsaufgabe von Ländern, Schulen und Kommunen, die ihre Rollen entsprechend ausfüllen müssten.
Ausblick: Was jetzt?

Zum Abschluss gab Holger Schleper, Redakteur bei Table-Briefings, einen Einblick in die aktuellen Debatten der Bildungspolitik. Gemeinsam mit seinen Kolleg*innen setzt er sich bei Bildung.Table, einem Medium für die Bildungsszene, mit aktuellen Bildungsthemen auseinander. Konkrete Themen, die die Bildungspolitik in Deutschland 2025 prägen werden, seien neben dem Umgang mit dem Lehrkräftemangel und dem Mangel an pädagogischem Personal in den Kitas auch das Zusammenwachsen von frühkindlicher und schulischer Bildung sowie die Digitalisierung und der Einsatz von KI in der Schule. Außerdem sei auch die Frage, wann der DigitalPakt 2 komme, zentral.
Und die ganz große Frage bleibt auch in der Bildungspolitik: Wie reformiert man ein Bildungssystem ganzheitlich?
Zur Beantwortung dieser Frage griff Schleper auf einige Punkte aus dem Buch „Das lernende Schulsystem“ von Anne Sliwka und Britta Klopsch zurück:
- Strategische Metaziele
- Datengestützte Schulentwicklung
- Vernetzte Autonomie von Schulen
- Professionelles Vertrauen und kooperative Professionalität
- Transformative Führung
Schleper blickt positiv in das Jahr 2025. Mit der anstehenden Bundestagswahl, einer Landtagswahl und der neuen KMK-Präsidentin Simone Oldenburg (Mecklenburg-Vorpommern) habe das Jahr Potenzial für viele Veränderungen. Auch das Startchancen-Programm des Bundes, das 4.000 allgemeinbildende und berufliche Schulen in Deutschland unterstützt, sieht er als Chance.

In der abschließenden Diskussion blieb trotz aller positiver Beispiele in der Sitzung Einigkeit zu einer Frage: Es gibt noch viel zu tun im Bereich digitale Bildung in Deutschland. Der DigitalPakt war zwar ein Schritt in die richtige Richtung, an der Umsetzung hat es aber an vielen Stellen noch gehakt. Diese Probleme müssen gründlich analysiert werden, um aus den gemachten Fehlern zu lernen und die Umsetzung des nächsten DigitalPakts effektiver zu gestalten. Nur so kann eine zukunftsfähige digitale Bildungsinfrastruktur geschaffen werden, die den Anforderungen der heutigen Zeit gerecht wird.



