Gemeinsam diskutieren, gemeinsam gestalten: Digitalpolitische Gelingensbedingungen für einen zukunftsfähigen Staat und eine resiliente Gesellschaft
Wie kann die Zukunftsfähigkeit des Staats und der Gesellschaft in Deutschland bis 2029 sichergestellt werden? – Im interaktiven Austausch diskutierten Vertreter*innen aus Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft über Wege zur Zukunftsresilienz, Stärkung der Digitalkompetenzen sowie notwendige staatliche Neustrukturierungen und einen Kulturwandel in der Verwaltung. Anlass war die Veröffentlichung des gemeinsamen Papiers „Deutschland 2029” vom DigitalService, SPRIND und Initiative D21.
Berlin/virtuell. Wie gestalten wir ein digitales Deutschland, in dem wir auch 2029 gerne leben? Welche digitalpolitischen Weichen müssen wir heute stellen, um Zukunftsresilienz, Innovation und gesellschaftliche Teilhabe zu fördern? Und welche Rolle kann und muss der Staat dabei spielen? Mit diesen Fragen hat sich die Initiative D21 gemeinsam mit der Digital Service GmbH des Bundes und der Agentur für Sprunginnovation (SPRIND) auseinandergesetzt. Herausgekommen ist das Papier „Deutschland 2029“, in dem digitalpolitische Gelingensbedingungen benannt werden. Diese Gelingensbedingungen vorzustellen und vor allem aber sie mit unserem Netzwerk zu diskutieren, war Ziel des Formats „Lunch & Learn“ der AG Innovativer Staat.
Staatliche und gesellschaftliche Handlungsfähigkeit durch Zukunftsresilienz stärken
Als Diskussionsgrundlage stellte zunächst Jörg Resch von der SPRIND die Bedeutung von Zukunftsresilienz für Staat und Verwaltung vor – und was überhaupt unter dem Begriff zu verstehen ist:
Zukunftsresilienz bedeutet, den Wandel proaktiv zu gestalten und heute zukunftsfähige Lösungen für morgen zu entwickeln.
Für den Staat sei diese Widerstands- und Anpassungsfähigkeit enorm wichtig, um in der Zukunft handlungsfähig zu sein. Für die Zukunftsresilienz sind laut Resch vier Handlungsfelder zentral:
- die digitale Souveränität
- ein gemeinsames Verantwortungsbewusstsein von Politik, Verwaltung, Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft
- eine Neustrukturierung des Staats
- Digitalkompetenzen der Bürger*innen.
Deutschland 2029 – Eine staatliche Reorganisation mit Weitblick
Über die notwendige Neustrukturierung des Staats im Bereich der Verwaltungsdigitalisierung gab anschließend Joshua Pacheco, vom DigitalService einen kurzen Input. Die im Papier „Deutschland 2029“ vorgeschlagene Reorganisation sehe eine zentrale politische Verantwortung auf Ministerialebene vor, die auch eine ressortübergreifende Kooperation und Koordination einschließe. Zudem sei eine Bündelung finanzieller Mittel notwendig, genauso wie stärkere Gestaltungsmandate sowie Umsetzungs- und Steuerungskompetenzen des nachgeordneten Bereichs. Zuletzt müssten auch technische Infrastrukturen, Plattformen und Basisdienste wirksam skaliert werden – und die Skalierbarkeit bei der Entwicklung von Beginn an mitgedacht werden.
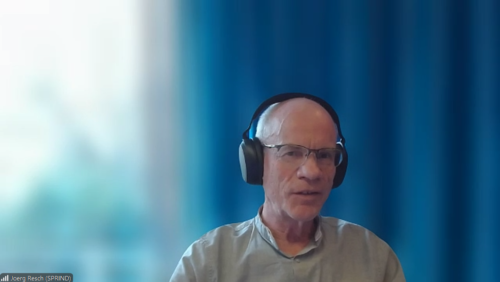


Digitalkompetenzen als Schlüssel der Zukunftsfähigkeit
Doch eine Neustrukturierung allein reiche nicht aus, um die Zukunftsfähigkeit des Staats und der digitalen Gesellschaft sicherzustellen, betonte Sandy Jahn, Initiative D21. Ein ebenso zentraler Baustein seien Digitalkompetenzen, denn:
Nur eine digital mündige Gesellschaft ist eine zukunftsfähige Gesellschaft.
Dabei zeige der aktuelle D21-Digital Index 2024/25, dass nur 49 % der deutschsprachigen Bürger*innen über alle fünf digitalen Basiskompetenzen verfügen. Deswegen brauche es dringend eine digitale Kompetenzoffensive, unter anderem in Form einer nationalen Kompetenzstrategie, die mit ausreichend finanziellen und personellen Ressourcen auf allen staatlichen Ebenen ausgestattet ist und die verschiedene Sozialpartner*innen, die Wirtschaft und Wissenschaft einbindet. „Eine Digitalkompetenzoffensive ist ziemlich alternativlos“, hielt Jahn abschließend fest. Deutschland liege bereits unter dem EU-Durchschnitt: „Ein weiteres Zurückfallen können wir uns nicht leisten .“
Herausforderungen, Perspektiven, Maßnahmen: im gemeinsamen Austausch zur digitalen Zukunft
Im Anschluss an die Impulse rückte bei der Diskussion der Teilnehmenden vor allem die Frage in den Vordergrund, wie ein Kulturwandel auch durch neue Organisationsformen vorangetrieben werden kann, um nicht nur Digitalkompetenzen in der Verwaltung zu stärken, sondern auch die Verwaltungsdigitalisierung insgesamt zu beschleunigen. Neue Organisationsformen etwa in Form einer Digitalagentur seien unter anderem deshalb ein Ansatzpunkt, weil Hierarchien keine Antworten mehr auf gängige Probleme gäben. Allerdings wurde diesem Vorschlag entgegnet, dass eine Externalisierung von ministeriellen Aufgaben an Agenturen zwar hinsichtlich des Kulturwandels einen Stein ins Rollen bringen könnte; allerdings könnten Agenturen nur Zugpferde sein. Der Wandel selbst müsse auch innerhalb der Verwaltung stattfinden.
Dafür brauche es aber Führungskräfte, die den Kulturwandel und die Verwaltungsdigitalisierung aktiv vorlebten. Doch auch ein Kulturwandel auf Führungsebene sei allein nicht ausreichend. Vielmehr müsse auch die Formalstruktur der Verwaltung grundlegend geändert werden. Viel zu häufig würden Macher*innen innerhalb der Verwaltung Steine in den Weg gelegt, beispielsweise durch die Gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesministerien (GGO), die gewissen Formen der Zusammenarbeit vorschreibe. Deswegen müssten auch formale Regelungen innerhalb der Verwaltung an die neuen technischen Möglichkeiten der Digitalisierung angepasst werden.

Weiterhin tauschten sich die Teilnehmenden intensiv über die Skalierbarkeit von Pilotprojekten, Prozesskompetenzen und darüber aus, warum der Föderalismus oftmals (zu) negativ im Kontext der Digitalisierung dargestellt werde. Als Gründe wurden fehlende gemeinsame interföderale Infrastrukturen identifiziert. Zudem brauche es eine gemeinsame Arbeits- und Zielgrundlage, die ausreichend Handlungsfreiheiten bereithält. Der föderale Staatsaufbau habe aber insgesamt unter anderem bei der Cybersicherheit echte Stärken.
Zusammenfassend, so wurde in der Diskussion erkenntlich, müssen einige Weichen gestellt werden, damit Staat und Gesellschaft zukunftsresilient werden. Doch einige Wege dazu wurden in dem Lunch & Learn diskutiert – und finden sich nicht zuletzt im Papier „Deutschland 2029“. Sie müssen nur noch gegangen werden.


